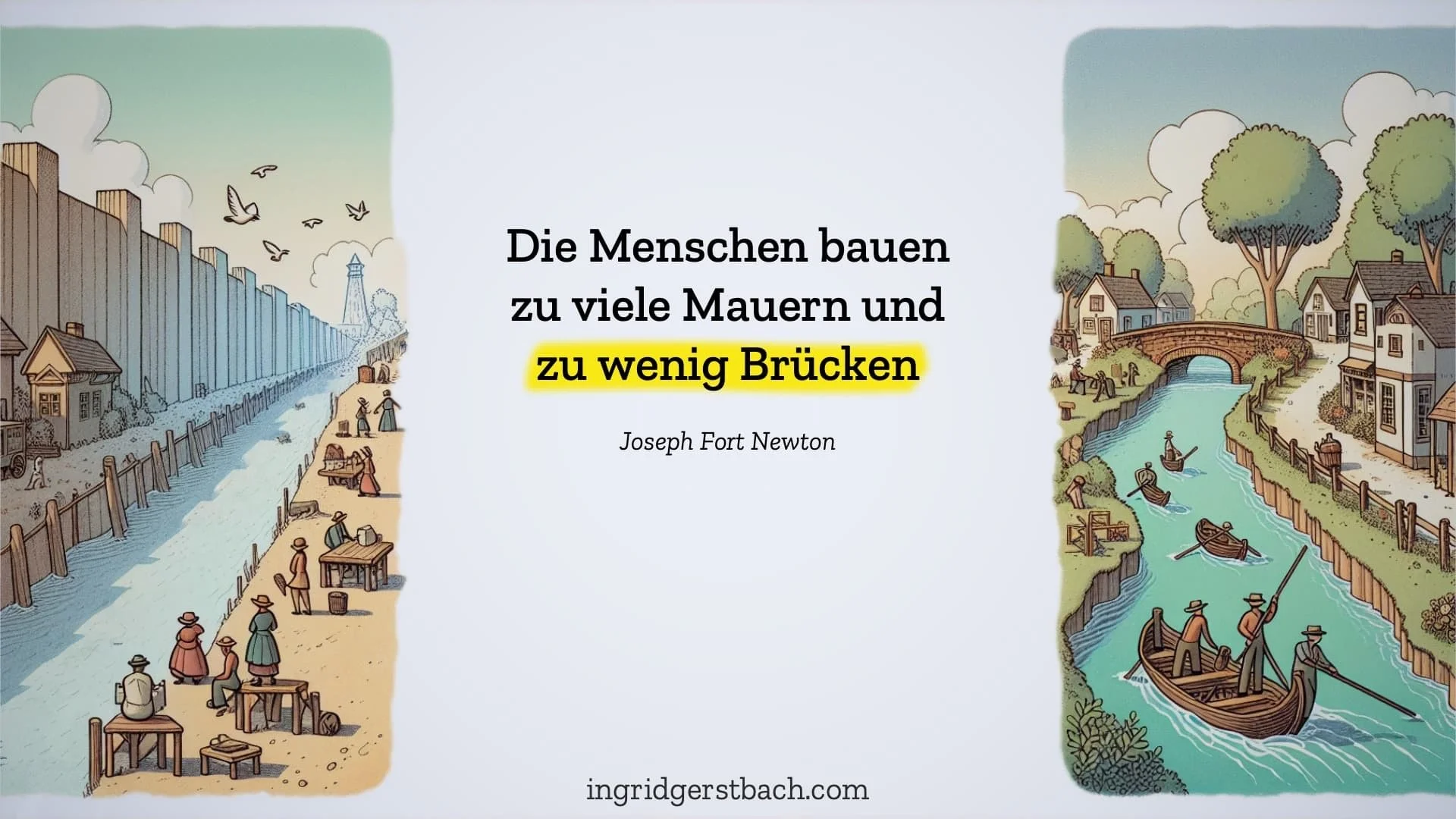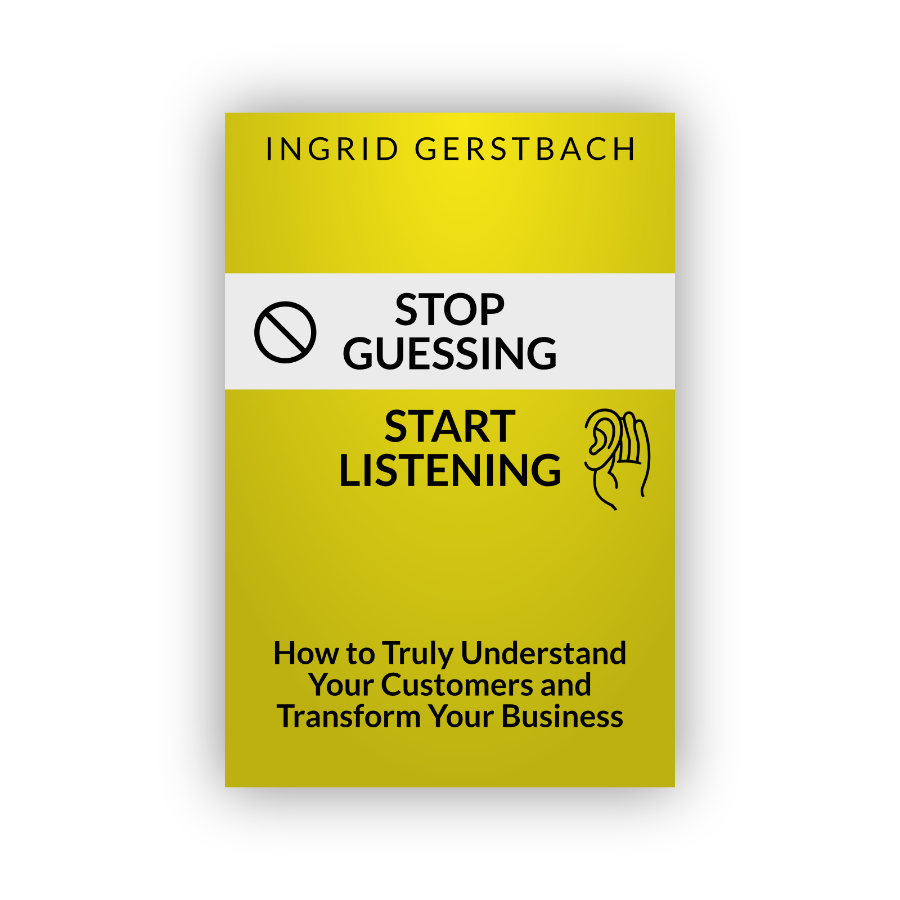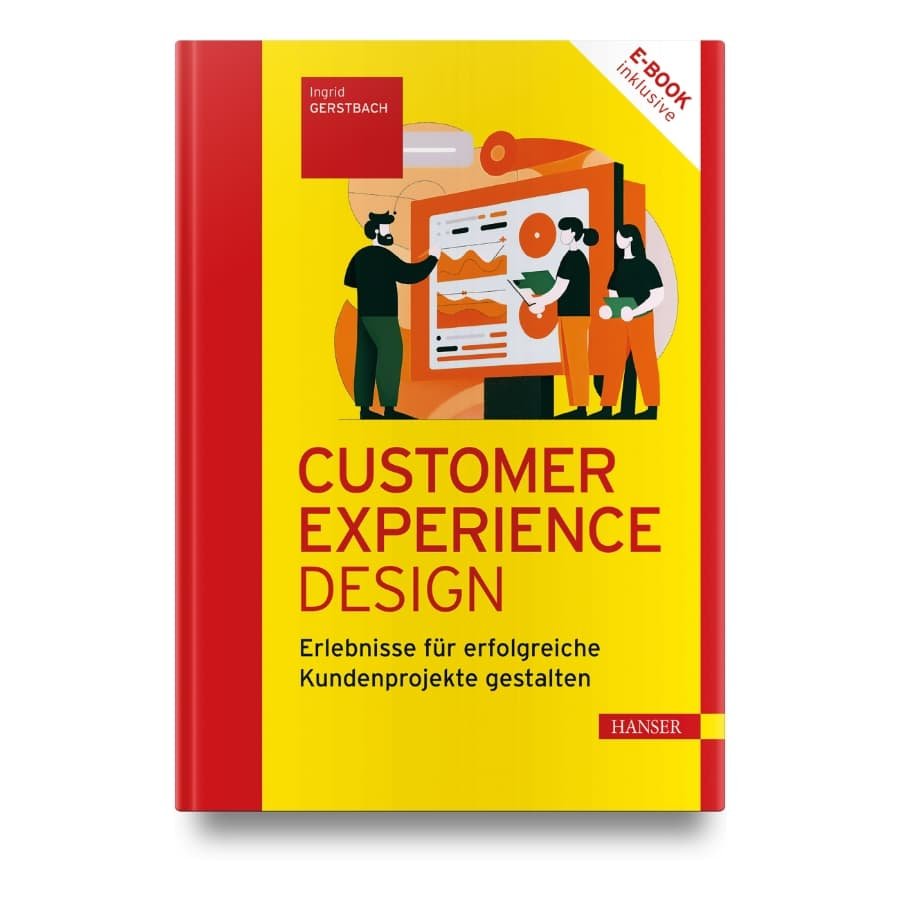Letzten Monat saß ich mit dem Geschäftsführer eines großen Unternehmens zusammen, der mir gestand: „Ingrid, wir haben die besten Experten, modernste Technologie und trotzdem scheitern wir an etwas so Banalem wie der Kommunikation zwischen Teams”. Er schwieg kurz, bevor er fortfuhr: „Wir sind brillant darin, Expertisen zu entwickeln, aber miserabel darin, sie zu verbinden”.
Diese Unterhaltung führte mich zu einer einfachen, aber tiefgreifenden Erkenntnis, die der baptische Pfarrer Joseph Fort Newton vor Jahrhunderten schon formulierte: „Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken”. In all den Jahren als Unternehmensberaterin habe ich festgestellt, dass dieser Satz nicht nur eine philosophische Beobachtung ist – er ist die versteckte Formel hinter nahezu jedem beruflichen und persönlichen Erfolg.
Ich habe eine ungewöhnliche Angewohnheit: Wann immer ich auf Erfolgsgeschichten stoße, suche ich nach den „unsichtbaren Verbindungen” dahinter. Die Antworten überraschen mich immer wieder. Wie zum Beispiel die Geschichte hinter einem Entwicklungsteam, das eines der erfolgreichsten Medikamente der letzten Dekade entwickelte. In einem Interview erwähnten sie nicht primär ihre wissenschaftliche Brillanz. Stattdessen betonten sie etwas, das sie als „radikale Querverbindungen” bezeichneten – die Fähigkeit von Biochemikern, klinischen Forschenden und Marketingexperten, auf eine Weise zusammenzuarbeiten, die ihre Silos transzendierte.
Die Daten bestätigen dieses Muster mit erstaunlicher Konsistenz. Eine Studie der Stanford University analysierte über 200 hochinnovative Projekte und entdeckte, dass der stärkste Prädiktor für bahnbrechende Innovation nicht die technische Expertise war, sondern die „Netzwerkdichte” zwischen unterschiedlichen Wissensbereichen.
Der Grund für diese Isolation liegt oft nicht in böser Absicht, sondern in unserer neurobiologischen Grundausstattung. Unser Gehirn ist darauf programmiert, Sicherheit zu suchen und Unsicherheit zu vermeiden. Die Evolution hat uns gelehrt, dass das Unbekannte gefährlich sein könnte. Aber in unserer heutigen Arbeitswelt ist diese einst hilfreiche Heuristik zu einem Hindernis geworden.
„Aber warum bauen wir dann so viele Mauern?”, fragte mich eine Teilnehmerin nach einem meiner Vorträge. Die Antwort liegt tief in unserer Neurobiologie. Die Georgetown University untersuchte, wie unser Gehirn auf berufliche Zusammenarbeit reagiert. Die Ergebnisse waren aufschlussreich: Wenn wir mit Menschen aus anderen Fachbereichen, mit anderen Denkweisen oder unterschiedlichen Hintergründen konfrontiert werden, aktiviert unser Gehirn dieselben Regionen, die auch bei physischer Bedrohung aktiv werden.
Mit anderen Worten: Unser Gehirn behandelt kognitive Diversität als potenzielle Gefahr. Die Ironie ist brutal: Was wir am dringendsten für Innovation brauchen – die Kollision unterschiedlicher Perspektiven – wird von unserem Gehirn instinktiv abgewehrt. Was passiert, wenn wir diesen biologischen Impuls überwinden? Die Resultate sind nicht nur positiv – sie sind exponentiell.
In einem Experiment mit 87 Produktentwicklungsteams untersuchten Forscher der MIT Sloan School of Management den Zusammenhang zwischen „Brückenbauerkapazität” (der Fähigkeit, Wissen über Abteilungsgrenzen hinweg zu transferieren) und Innovationserfolg.
Die Ergebnisse verblüfften selbst die Forscher: Eine 20% Steigerung der Brückenbauerkapazität korrelierte mit einer 70% Steigerung erfolgreicher Markteinführungen. Noch bemerkenswerter: Diese Teams benötigten durchschnittlich 33% weniger Zeit vom Konzept zur Marktreife.
Wie können wir diese Erkenntnisse in unseren beruflichen Alltag integrieren? Hier sind drei Praktiken, die ich selbst anwende und die ich meinen Klienten empfehle:
1. Praktizieren Sie bewusste Neugier: Stellen Sie sich vor, jede Person, der Sie begegnen, hat mindestens eine wichtige Lektion für Sie. Formulieren Sie in Meetings Fragen, die mit „Hilf mir zu verstehen...“ beginnen. Eine Studie der Yale University zeigt, dass Teams, die regelmäßig offene Fragen stellen, um 31% bessere Entscheidungen treffen.
2. Etablieren Sie regelmäßige Perspektivwechsel: Bei einem globalen Technologieunternehmen führte ich ein einfaches Ritual ein: In kritischen Projektsitzungen musste jeder Teilnehmende kurz die Position eines anderen Team-Mitglieds vertreten. Das Ergebnis? Eine Reduktion von Konflikten um die Hälfte und eine Steigerung der Lösungsqualität um ein Drittel.
3. Investieren Sie in informelle Verbindungen: Die wahre Magie in Organisationen geschieht oft nicht in formellen Meetings, sondern in den Zwischenräumen. Schaffen Sie bewusst Gelegenheiten für unstrukturierte Interaktionen. Ein 15-minütiger Kaffeetratsch mit einem Kollegen aus einer anderen Abteilung bewirkt oft mehr als ein einstündiges formelles Meeting.
Das Faszinierendste am Brückenbauen ist vielleicht seine doppelte Dividende: Während es Organisationen transformiert, verändert es auch uns selbst.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Teilnehmer nach einem Workshop. Er wirkte nachdenklich und sagte dann: „Weißt du, ich habe immer gedacht, dass meine größte Stärke mein Fachwissen ist. Jetzt erkenne ich, dass es meine Fähigkeit ist, Fachwissen zu verbinden”. Seine Erkenntnis entspricht der Forschung zur beruflichen Entwicklung, die zeigt, dass der berufliche Aufstieg ab der mittleren Karrierestufe weniger von fachlicher Vertiefung abhängt als von der Fähigkeit, Expertise zu orchestrieren und Beziehungen über Grenzen hinweg zu navigieren.
Sehen Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld um. Wo stehen die unsichtbaren Mauern? Zwischen welchen Kollegen, Abteilungen oder Perspektiven fehlen die entscheidenden Brücken? Noch wichtiger: Welche Brücke könnten Sie heute bauen?
Vielleicht ist es der Kollege mit dem kontroversen Standpunkt, mit dem Sie noch nie ein wirklich tiefgreifendes Gespräch geführt haben. Vielleicht ist es die Abteilung, deren Prioritäten Ihnen immer rätselhaft erschienen. Oder vielleicht ist es Ihre eigene Komfortzone – die Mauer, die Sie um Ihre etablierten Überzeugungen und Arbeitsweisen errichtet haben.
In unserer zunehmend polarisierten Welt ist die Fähigkeit, Brücken zu bauen, nicht nur ein beruflicher Vorteil – sie ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit und eine Quelle tiefer persönlicher Erfüllung.
Wie der Philosoph Martin Buber schrieb: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung”. In diesem einfachen Satz liegt vielleicht die tiefste Wahrheit über das Brückenbauen: Es ist nicht nur der Weg zu beruflichem Erfolg – es ist der Weg zu einem reicheren, verbundeneren und bedeutungsvolleren Leben.
Die Frage ist nicht, ob wir Brücken bauen sollten. Die Frage ist, mit welcher Brücke wir heute beginnen.